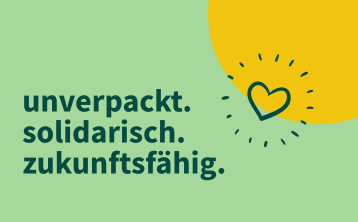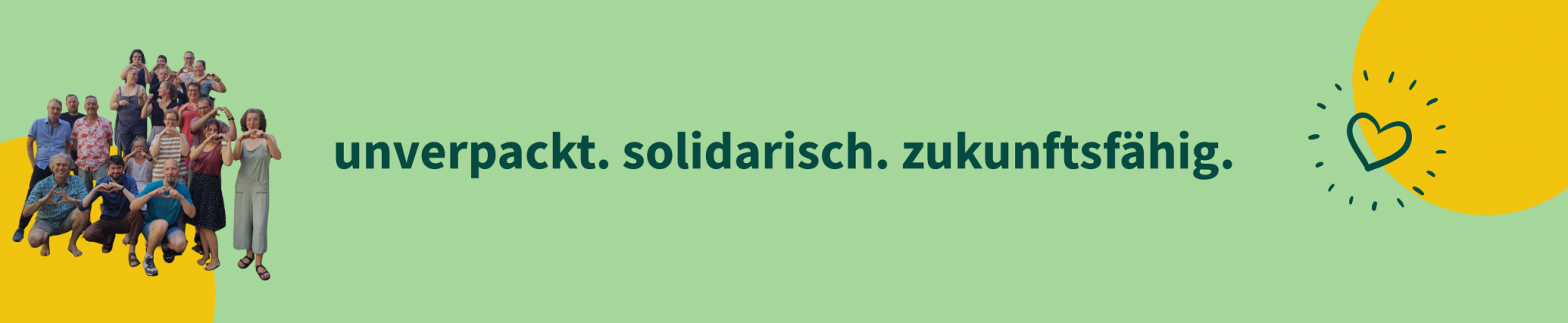
Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften im Unverpacktladen
Unverpacktes Einkaufen ist mehr als nur den Verzicht auf Plastikverpackungen. Es ist gelebte Praxis einer anderen Art zu wirtschaften. Dabei schlagen immer mehr Unverpacktläden den Weg einer gemeinschaftsbasierten Ökonomie ein – ökologisch, solidarisch, zukunftsfähig.
Unverpacktes Einkaufen steht für eine andere Art des Wirtschaftens – ökologisch, aber auch sozial. Neben Ressourcenschonung und der Vermeidung von Plastik setzen Unverpacktläden auf möglichst regionale Bio-Produkte sowie faire und transparente Lieferketten. Von den mehr als 200 Unverpacktläden in Deutschland gehen immer mehr noch einen Schritt weiter: Kund:innen werden zu Mitgestalter:innen. Die Läden organisieren sich gemeinschaftlich, solidarisch und kooperativ und teilen dabei Verantwortung. Einige, wie z. B. Lingen Unverpackt und Glas & Beutel in Nürtingen, arbeiten als Genossenschaft, andere, wie z. B. Emmas Unverpackt in Fulda (Hyperlink) oder Frau Lose in Dortmund sind Vereine. Der Kaufladen Speyer oder die Erbsenzählerei in Berlin funktionieren als Mitgliederläden.
Diese Entwicklung ist Teil einer wachsenden Bewegung der letzten Jahre: In Zeiten von Klimakatastrophe, ökonomischer Unsicherheit und gesellschaftlichen Spannungen suchen Menschen nach Stabilität und Sinn. Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften schafft Vertrauen, Widerstandsfähigkeitund Räume für Mitgestaltung – eine Einladung, Wirtschaft neu zu denken.
Was ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften?
Im Kern geht es um eine Abkehr von rein marktorientierten Logiken. Statt Profitmaximierung und Konkurrenz stehen tragfähige Beziehungen und Kooperation im Mittelpunkt. Das Modell ist keine festgelegte Rechtsform, sondern ein Selbstverständnis: Kund:innen werden Mitglieder, die Verantwortung teilen – etwa indem sie Kosten vorfinanzieren, sich aktiv austauschen oder im Laden mitarbeiten. So entsteht ein Miteinander, das von Vertrauen und Transparenz geprägt ist.
Gemeinschaft als Resonanzerfahrung
Aus Transaktion wird Resonanz: Ein zentrales Element ist die Vorfinanzierung durch Mitglieder – etwa für Miete, Gehälter oder Fixkosten. So verteilt sich das wirtschaftliche Risiko auf viele Schultern. Die Betreiber:innen können so sicherer planen. Die Mitglieder bekommen einen tieferen Einblick in die Realität des Ladens und die Möglichkeit, Verantwortung mitzutragen.
So verändert sich Beziehung: aus einer finanziellen Transaktion wird ein Resonanzraum. Geld ist nicht mehr nur Tauschmittel, sondern Ausdruck von Unterstützung, Vertrauen und Wertschätzung. Wenn ich weiß, dass der leckere Aufstrich im Regal steht, weil ich den Einkauf vorfinanziert habe, erlebe ich mich als selbstwirksam und zugehörig. Auch die Ladenbetreiber:innen erfahren eine neue Qualität der Beziehung. Anstelle reiner Kaufakte entsteht Nähe: mehr Feedback und Austausch, weniger ökonomische Isolation. Neben ökonomischer Sicherheit entsteht emotionale Verbundenheit.
Unverpacktläden sind ohnehin Orte der Begegnung: Man kennt sich beim Vornamen, plaudert beim Abfüllen. In gemeinschaftsbasierten Modellen ist diese Qualität noch stärker und Nähe und Verbundenheit tragen im besten Fall auch in Krisen. Erlebe ich mich als Teil einer Gemeinschaft, bleibe ich ihr eher treu – Resonanz wird zu Resilienz. Aus einem Ort, an dem ich „nur“ einkaufe, wird ein Ort geteilter Wirksamkeit und damit ein Stück gelebte Gesellschaftsgestaltung.

Gemeinschaft als politischer Akt
Gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften ist politisch. Wenn Menschen nicht nur konsumieren, sondern aktiv mitgestalten, entsteht ein Raum für Demokratie im Alltag. Hier wird geübt, was unsere Gesellschaft braucht: zuhören, Kompromisse finden, Verantwortung übernehmen. Solidarische Finanzierungsmodelle, kollektive Eigentumsformen und partizipative Entscheidungsstrukturen zeigen im Kleinen, wie eine faire und nachhaltige Ökonomie funktionieren kann.
Das ist ein Gegenentwurf zu bestehenden Strukturen: Viele Geschäftsmodelle beruhen auf Ausbeutung von Menschen und Tieren sowie Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Die ökologischen und sozialen Folgekosten werden kaum eingepreist, sondern von der Allgemeinheit getragen – heute und in Zukunft. Staatliche Rahmenbedingungen korrigieren das bislang nur unzureichend, oft werden destruktive Praktiken sogar subventioniert.
Vor diesem Hintergrund sind Unverpacktläden ein alternatives Modell: Sie setzen auf ein ökologisch tragfähiges, sozial gerechtes Modell. Allerdings werden diese Grundsätze bislang kaum durch politische Maßnahmen unterstützt. Wer sich dafür entscheidet, sich an einem gemeinschaftsgetragenen Unverpacktladen zu beteiligen, trifft damit also eine politische Entscheidung „von unten“; eine bewusste Wahl für eine andere Zukunft. Das hat Signalwirkung. Es zeigt: Eine andere Wirtschaft ist nicht nur denkbar, sondern machbar.
Gemeinschaft als Zukunftskompetenz
Die großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimakatastrophe, soziale Ungleichheit, Ressourcenknappheit – lassen sich nicht allein lösen. Sie erfordern Kooperation. Derzeit priorisieren wir gesamtgesellschaftlich allerdings noch viel zu oft Profit über geteilte Verantwortung und Konkurrenz über Kooperation. Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften bietet dazu nicht nur eine Alternative, sondern erfordert existenziell notwendige Zukunftskompetenzen.
In gemeinschaftsgetragenen Modellen üben Menschen, wie lebensdienliche Kooperation funktioniert – wirkliches Zuhören, Lösungen zum Wohle aller aushandeln und geteilte Verantwortung für Entscheidungen.
Zudem fördert diese Form des Wirtschaftens Resilienz. Wer sich auf stabile Beziehungen verlassen kann, reagiert flexibler auf Krisen. Anstatt auf rein marktgetriebene Mechanismen zu setzen, entsteht ein Netzwerk, das nicht nur Produkte, sondern auch Zugehörigkeit und Sicherheit liefert.
Kurz gesagt: Gemeinschaft ist nicht nur eine romantische Idee, sondern eine Überlebensstrategie. In einer Zukunft, die unvorhersehbar und komplex bleibt, brauchen wir weniger Gegeneinander und mehr Miteinander. Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften macht das erfahrbar.

Risiken und Herausforderungen
So inspirierend gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften klingt – die Praxis bringt auch Herausforderungen mit sich:
- Hoher Organisationsaufwand: Beteiligung braucht Strukturen. Entscheidungsprozesse dauern oft länger, weil viele Stimmen berücksichtigt werden müssen.
- Finanzielle Belastung: Solidarische Modelle machen wirtschaftlich unabhängiger, sind aber anfällig, wenn zu wenige Mitglieder aktiv Verantwortung übernehmen oder Beiträge ausbleiben.
- Konfliktpotenzial: Unterschiedliche Erwartungen und Rollenverständnisse können zu Spannungen führen. Transparente Kommunikation und klare Vereinbarungen sind essenziell.
- Marktdruck: Gemeinschaftsmodelle schützen nicht vor ökonomischen Realitäten. Preis- und Sortimentserwartungen der Kundschaft bleiben ein Balanceakt zwischen Idealismus und Wirtschaftlichkeit.
Trotz dieser Hürden zeigt die Praxis: Wo Haltung, Strukturen und gelebte Beziehungen stimmen, entstehen resilientere Modelle.
Gelingensbedingungen
Damit gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften gelingt, braucht es vor allem drei Dinge:
- Haltung – die innere Ausrichtung: Offenheit, Vertrauen, Wertschätzung, Fehlerfreundlichkeit, die Bereitschaft, Verantwortung zu teilen/zu übernehmen.
- Strukturen – die organisatorische Basis: Räume und Prozesse für Partizipation, transparente Entscheidungswege, gemeinschaftliche Eigentumsmodelle oder solidarische Finanzierung, faire Verteilung von Arbeit und Risiko.
- Beziehungen – gelebte Gemeinschaft: Kommunikation auf Augenhöhe, kontinuierlicher Austausch, eine Kultur des Dialogs und Bereitschaft zum gemeinsamen Lernen
Fazit
Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist mehr als ein Geschäftsmodell. Es ist gelebte Gesellschaftsgestaltung – konkret und zukunftsfähig. Doch es ist kein Selbstläufer: Ohne klare Strukturen, Engagement und Dialog droht Überforderung. In den kommenden Monaten stellen wir hier Unverpacktläden vor, die diesen Weg gehen – als Genossenschaften, Vereine oder Mitgliederprojekte.
Mehr Infos
Ihr findet gemeinschaftsbasierte Konzepte spannend und wollt Euch dazu beraten lassen? Schaut mal hier:
Schon gewusst? Auch wir wollen stärker gemeinschaftsbasiert Wirtschaften und dafür eine Einkaufsgenossenschaft für Unverpacktläden gründen. Mehr Infos hier.

Lisa Schulze
Lisa ist überzeugt: Die gute Zukunft für alle entsteht dort, wo Menschen gemeinsam und solidarisch handeln. Sie liebt Nachbarschaftsnetzwerke, in denen Menschen füreinander da sind – mit Zucker für Pfannkuchen, guten Büchern im Kreislauf und mit Zeit für gegenseitige Unterstützung. Für das Online-Magazin des Unverpacktverbandes spricht sie mit Unverpacktläden, die gemeinsam wirtschaften und neue Wege gehen – gemeinschaftlich, nachhaltig, zukunftsfähig
Du hast noch Fragen? Kontaktiere mich unter Kontaktier mich unter office@unverpackt-verband.de.